Eine Hard ScFi Short Story im AIOLUS Kosmos inspiriert durch aktuelle Webb-Daten über CT Cha b, 625 Lichtjahre entfernt. NASA’s Webb Telescope Studies Moon-Forming Disk Around Massive Planet
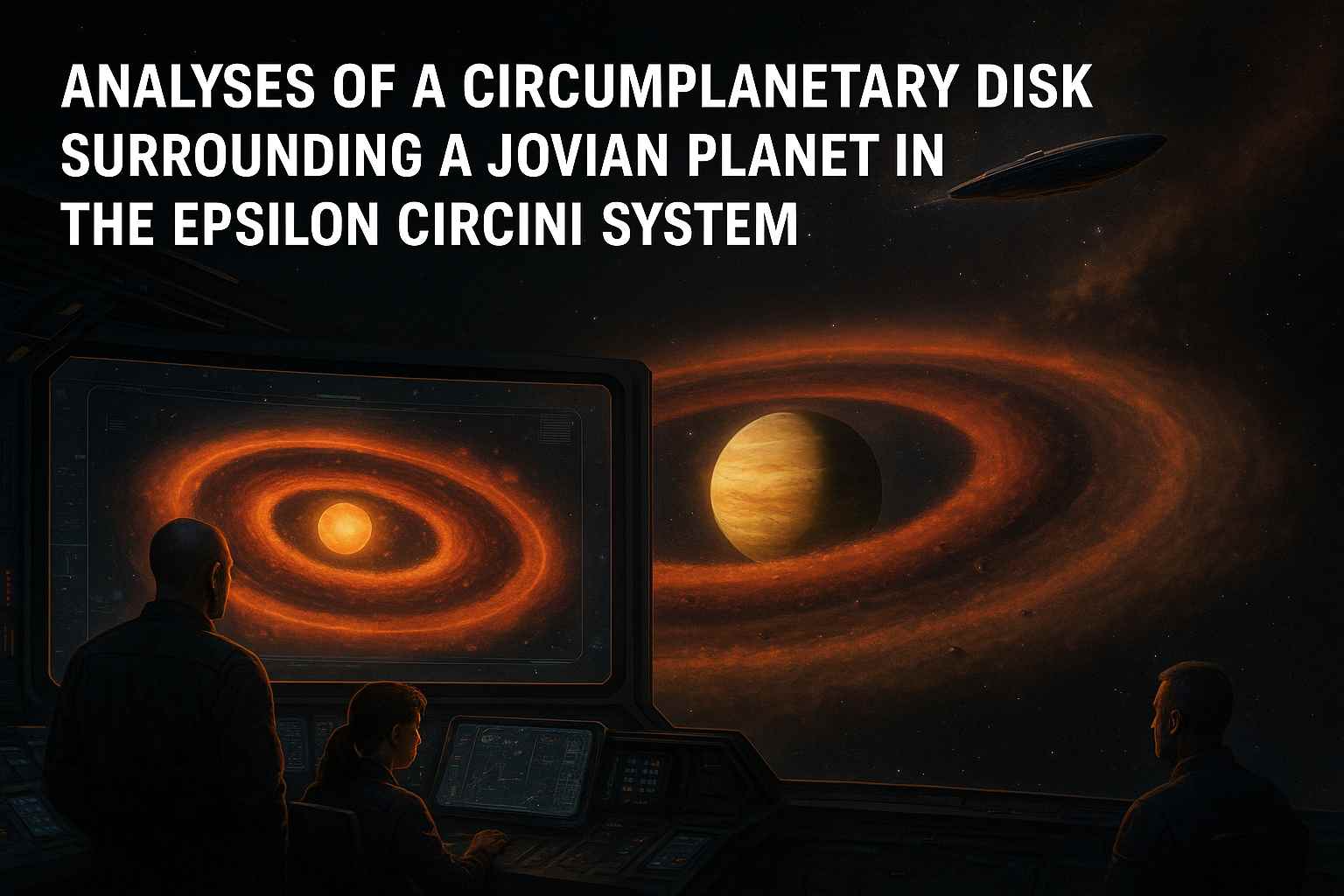
Das Schiff tauchte aus dem Subraum auf. Skellie nahm die Hände von den Kontrollfeldern und atmete aus. Schweiß stand auf ihrer wachsweißen Stirn.
»Instabile Schicht«, meldete sie. »Aber wir sind durch.«
»SAM, Lagebericht.«
»System SORD-H17-4421. Relativgeschwindigkeit null Komma drei c. Alle Systeme grün.«
Die Bildwand erwachte. SAM legte die Sensordaten in Schichten an. Zuerst optisches Spektrum: ein junger Stern, etwa drei Millionen Jahre alt, eingehüllt in eine trübe protoplanetare Scheibe. Dann Infrarot überlagert. Verwirbelungen, Klumpen, dunkle Bänder traten hervor.
»Position des Gasriesen?«
»Eins-sieben-drei, minus vier Grad Ekliptik. Entfernung zum Zentralstern achtzig Milliarden Kilometer. Masse zehn Jupitermassen. Alter geschätzt zwei Millionen Jahre.«
Die Bildwand zoomte. Ein diffuser Fleck, noch zu weit entfernt für Details.
»Annäherung, Sergeant. Standard-Scan-Kurs.«
»Verstanden, Sir.«
Die AIOLUS glitt näher. Sechs Stunden Flugzeit. Die Bildwand aktualisierte kontinuierlich. Der Fleck wurde größer, nahm Form an. Ein blassgelber Ball, umgeben von einem diffusen Ring. Keine scharfen Kanten. Stürme über die Oberfläche. Blitze in den oberen Atmosphärenschichten.
»Vergrößerung auf die zirkumplanetare Scheibe.«
SAM passte die Darstellung an. Die Bildwand zoomte, synthetisierte aus multiplen Sensordaten ein kohärentes Bild.
Eine flache, rotierende Scheibe aus Gas und Staub umschloss den Planeten. Etwa dreihunderttausend Kilometer im Durchmesser. Die Struktur war unregelmäßig – Beulen, Klumpen, dunkle Streifen, helle Flecken. Aber eindeutig eine Scheibe.
»SAM, präzise Analyse.«
»Akkretionsgetriebene zirkumplanetare Struktur. Masse etwa null Komma eins Erdmassen. Optische Tiefe tau gleich null Komma acht im mittleren Bereich. Rotationsperiode vierzehn Komma zwei Stunden. Temperaturverteilung: hundertfünfzig Kelvin im äußeren Bereich, vierhundert Kelvin nahe dem Planeten.«
SAM schaltete die Bildwand auf Infrarot. Die Darstellung wechselte, Falschfarben ersetzten das optische Spektrum. Die Scheibe leuchtete auf. Heißere Bereiche nahe dem Planeten glühten orange-rot. Kühlere äußere Regionen erschienen blau-violett. Ein klarer Temperaturgradient von innen nach außen, visualisiert durch SAMs Interpretation der thermischen Emission.
»Spektralanalyse läuft«, meldete CeCe von ihrer Station. »Ich kriege starke Linien im mittleren Infrarot. Kohlenwasserstoffe. Acetylen bei drei Komma null Mikrometer. Benzol bei drei Komma drei. Ethan bei drei Komma vier. Sehr ausgeprägt.«
»Vergleich mit stellarer Scheibe?«
SAM überlagerte die Spektraldaten auf der Bildwand. Zwei Graphen erschienen nebeneinander. Links das Spektrum der protoplanetaren Scheibe um den Stern: Wasserdampf bei sechs Komma eins Mikrometer, Silikat-Features bei zehn und achtzehn Mikrometer, Kohlenmonoxid bei vier Komma sieben. Rechts die planetare Scheibe: dominiert von organischen Kohlenwasserstoffen, kaum Wasser, deutlich kühler.
»Die Chemie ist völlig unterschiedlich«, sagte CeCe. »Die stellare Scheibe ist wasser- und silikatreich. Die planetare Scheibe ist kohlenstoffreich.«
»SAM, Interpretation?«
»Das Modell ist konsistent mit thermischer Prozessierung. Material aus der stellaren Scheibe fällt auf den Planeten. Hohe Temperaturen nahe der Oberfläche dissoziieren Wassermoleküle. Wasserstoff entweicht, Sauerstoff bindet an Metalle. Kohlenstoffverbindungen bleiben zurück. Dieses angereicherte Material bildet die zirkumplanetare Scheibe.«
SAM wechselte die Bildwand zurück zu optischen Wellenlängen. Die Scheibe rotierte langsam, eine flache Spirale aus Staub und Gas, rekonstruiert aus Dutzenden Sensordaten zu einem kohärenten Bild.
»Lokale Verdichtungen detektiert«, meldete SAM. »Vier signifikante Anomalien.«
Vier rote Markierungen erschienen auf der Bildwand. Zwei nahe am Planeten, im heißen inneren Bereich. Zwei weiter außen, in der kühleren Zone.
»Protomonde?« fragte Chambers.
»Wahrscheinlich. Lokale Masseansammlungen. Größenordnung null Komma null eins Erdmassen. Gravitationswechselwirkung mit umgebendem Material erkennbar.«
AR-7 stand an seiner Sensorstation. »Die Verdichtungen zeigen klare Spiralstrukturen im umgebenden Material. Hinweis auf Akkretion.«
»Zeitskala für Mondbildung?«
»Modelle variieren zwischen zehntausend und einer Million Jahren, abhängig von Materialdichte und lokaler Viskosität«, antwortete SAM.
»Der Planet ist zwei Millionen Jahre alt. Frühe Phase der Mondentstehung.«
SAM synthetisierte eine schematische Darstellung auf der Bildwand. Der Gasriese in der Mitte, die Scheibe darum, die vier Verdichtungen markiert. Pfeile zeigten Materialbewegung: von der stellaren Scheibe zum Planeten, vom Planeten in die zirkumplanetare Scheibe, von der Scheibe zu den Protomonden. Kein optisches Bild mehr, sondern ein Modell, aufgebaut aus Massendaten, Spektralanalysen, Gravitationsmessungen.
»Chief, können Sie die inneren und äußeren Regionen vergleichen?«
CeCe arbeitete an ihren Kontrollen. »Die inneren Bereiche sind heißer. Vierhundert Kelvin. Spektrum zeigt schwere Kohlenwasserstoffe. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe bei sieben bis acht Mikrometer. Die äußeren Bereiche sind kühler. Hundertfünfzig Kelvin. Spuren von Wassereis bei drei Komma eins Mikrometer. Gefrorenes Methan bei zwei Komma drei.«
»Interpretation?«
»Thermische Separation. Je näher am Planeten, desto heißer, desto weniger flüchtige Stoffe. Je weiter außen, desto kühler, desto mehr Eis. Wenn die Protomonde überleben und zu echten Monden werden, hätten wir zwei Typen. Felsige, kohlenstoffreiche Monde innen. Eisige Monde außen.«
»Wie im Jupiter-System«, sagte Chambers. »Io und Europa innen. Ganymed und Kallisto außen.«
»Präzise Analogie«, bestätigte SAM.
Skellie studierte die Gravitationsdaten auf ihrem Pult. »Die Scheibe zeigt Resonanzmuster. Quantenfluktuationen im erwarteten Bereich. Die Materieverteilung folgt Keplerscher Dynamik. Innere Bereiche rotieren schneller als äußere.«
Die AIOLUS kreiste weiter. Die Bildwand aktualisierte kontinuierlich, synthetisierte neue Perspektiven aus den rotierenden Sensordaten. Die Scheibe von oben: eine flache Spirale. Von der Seite: eine dünne Linie. Von schräg: die Struktur erkennbar, Klumpen, Lücken, Verwirbelungen. Keine Kamera hätte diese Ansichten liefern können – SAM rekonstruierte sie aus multiplen Messwerten.
»Weitere Anomalie detektiert«, meldete SAM. »Koordinaten vier-neun, Sektor B. Lokale Materialabwesenheit. Durchmesser etwa fünftausend Kilometer.«
SAM passte die Darstellung an. Die Bildwand zoomte auf die Position, überlagerte optische und Infrarotdaten. Tatsächlich: eine Lücke. Ein dunkler Fleck in der Scheibe. Kein Material, nur Leere.
»Lückenschlag«, sagte CeCe. »Wenn ein Protomond groß genug wird, räumt er seine Umlaufbahn frei. Er akkretiert das Material in seiner Nähe. Wir sehen das in Saturnringen.«
»SAM, können Sie den Protomond direkt detektieren?«
»Negativ. Zu klein, zu geringe thermische Emission. Aber die Lücke ist eindeutig. Und sie bewegt sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit. Orbital konsistent.«
AR-7 analysierte die Daten weiter. »Die Lücke ist nicht vollständig leer. Restmaterial zeigt Resonanzschwingungen. Periodizität konsistent mit Gravitationswechselwirkung eines Körpers von etwa null Komma null null eins Erdmassen.«
SAM generierte eine Animation auf der Bildwand. Die Lücke, dargestellt als dunkler Ring in der Scheibe. Ein unsichtbarer Punkt im Zentrum. Pfeile zeigten Materialbewegung: weg von der Lücke, aufgesaugt vom unsichtbaren Protomond. Eine Visualisierung, keine direkte Beobachtung.
»Dokumentation abgeschlossen«, meldete SAM nach weiteren zwei Stunden. »Alle relevanten Spektralbereiche erfasst. Optisch, Infrarot, Millimeterwellen. Dreidimensionale Struktur rekonstruiert. Gravitationskarte erstellt.«
»Katalogisierung?«
»System SORD-H17-4421. Zentralstern Spektralklasse K2, Alter drei Komma zwei Millionen Jahre. Planet P0002, zehn Jupitermassen, Alter zwei Millionen Jahre. Zirkumplanetare Scheibe, Durchmesser dreihunderttausend Kilometer, Masse null Komma eins Erdmassen. Vier bestätigte Protomonde. Ein zusätzlicher Protomond durch Lückenschlag indirekt nachgewiesen.«
»Übertragung der Daten an SORD vorbereiten.«
»Bereit zur Übertragung.«
Chambers stand auf und trat an die Bildwand. Die Scheibe füllte noch immer das rekonstruierte Bild. Millionen Tonnen Material in Rotation um einen jungen Planeten. Staub kollidierte mit Staub, verschmolz, wurde zu Kieseln, zu Brocken, zu Monden. Ein Prozess, der Jahrmillionen dauern würde.
»Kurs auf Rücksprung, Sergeant.«
»Verstanden, Sir.«
Skellie legte ihre Finger auf die Kontrollfelder. Ihre Augen schlossen sich kurz. Die AIOLUS drehte bei, beschleunigte. Die Scheibe wurde kleiner auf der Bildwand, ein leuchtender Ring um einen blassen Punkt. Dann nur noch ein Datensatz.
»Sprungpunkt erreicht in vier Stunden«, meldete SAM.
SAM wechselte die Bildwand zur Navigationskarte. Aber in einer Ecke blieb ein kleines Fenster aktiv. Die Scheibe, von weitem, noch immer synthetisiert aus Sensordaten. Ein letzter Blick.
Irgendwann, in Millionen Jahren, würde dieser Gasriese von einem Dutzend Monden umkreist werden. Manche würden Ozeane unter ihrer Eiskruste verbergen. Andere wären tote Gesteinsbrocken. Aber alle würden aus dieser Scheibe stammen.
Die AIOLUS verschwand in den Subraum.
Die Scheibe blieb. Still. Geduldig. Wartend.
(NASA, claude.ai, ChatGPT, AIOLUS Romane von Leonard Lionstrong)
